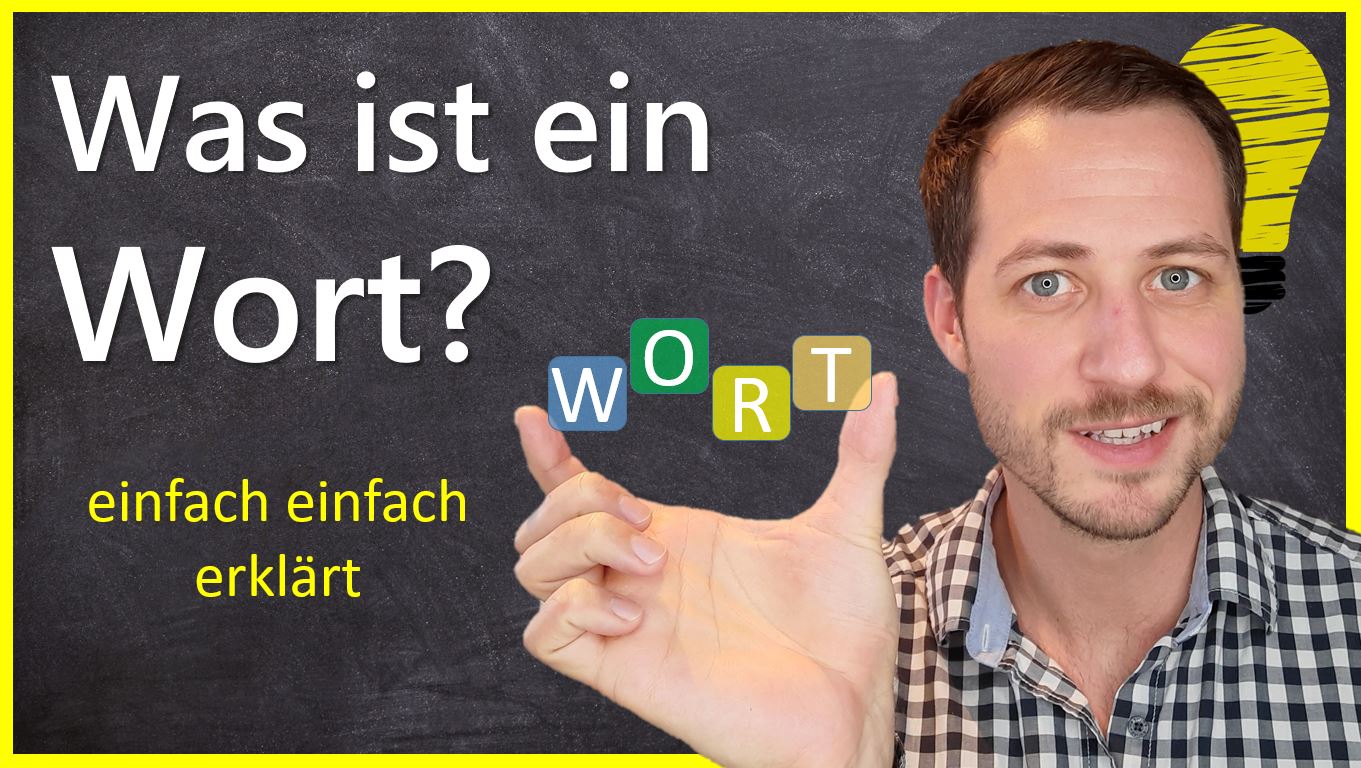Wörter sind aus Einheiten aufgebaut, die eine Bedeutung tragen. Diese Einheiten nennt man „Morpheme“. In der Linguistik sagt man dann: Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache.
Als Quelle verwenden (APA)
Methling, R. (2022, 02. Juli). Was ist ein Morphem? https://www.linguistik.online. Abgerufen am XX.XX.20XX, von https://linguistik.online/was-ist-ein-morphem/
Begriff
Das Wort „Morphem“ stammt vom griechischen Wort „morphḗ “, was „Form“ bedeutet.
In wie viele Einheiten, die alle für sich selber eine Bedeutung tragen, kannst du den folgenden Satz zerlegen?
„Ich habe Kopfweh.“
Wahrscheinlich denkst du an: Ich / habe / Kopf / weh. „Kopf“ und „weh“ werden getrennt, da jedes Wort eine eigene Bedeutung hat. Das ist aber nicht ganz richtig. Es sind fünf Morpheme, nämlich: Ich / hab / e / Kopf / weh /.
Das Wort „habe“ besteht aus zwei Morphemen. Also aus zwei Einheiten, die jeweils eine Bedeutung tragen. Das Morphem „hab-“ bedeutet so etwas wie „Besitz“, das ist klar. Welche Bedeutung hat dann die Endung „–e“? Das wird schnell deutlich, wenn man diese Endung durch eine andere z. B. „–en“ ersetzt: Ich / hab / en / Kopf / weh. Dies ist kein akzeptabler Satz, denn die Personenangabe des Subjekts, in diesem Fall das Personalpronomen „ich“, muss im Deutschen mit der entsprechenden Person des Verbs übereinstimmen. „Ich“ verweist auf die 1. Person im Singular. Darum ist es nicht möglich, zu sagen „Ich haben Kopfweh“ oder „Ich hat Kopfweh.“
Somit trägt die Endung „–e“ in „habe“ die (grammatische) Bedeutung:
– 1. Person Singular
– Präsens
– Indikativ
– Aktiv.
Viele Wortformen bestehen aus nur einem Morphem („ich“, „bei“, „schnell“). Die meisten enthalten aber mehrere Morpheme (hab / e, schnell / er).
Expertenwissen
Eigentlich habe ich in diesem ersten Teil den Begriff „Morphem“ nicht korrekt verwendet. Man unterscheidet in der Morphologie zwischen der konkreten Form (= Morph) und dem abstrakten Morphem. Zur Unterscheidung zwischen Morph und Morphem habe ich einen separaten Artikel verfasst.
Morpheme teilt man in freie, gebundene, grammatische und lexikalische Morpheme ein.
Was sind freie Morpheme?
Ein freies Morphem kann immer alleine stehen. Es benötigt also kein weiteres Morphem, um verwendet werden zu können. So kann das freie Morphem „Tisch“ genau so in dieser Form in einem Text auftreten. Es handelt sich bei den freien Morphemen um Simplexe. Ein Simplex ist ein Wort, das nur aus einem einzigen Morphem besteht und nicht weiter zerlegt werden kann. Freie Morpheme sind die Basismorpheme (auch: Grundmorpheme) der deutschen Sprache.
Beispiel
Freie Morpheme sind z. B. die Wörter „prima“, „Tisch“, „weil“ oder „auf“.
Die freien Morpheme einer Sprache kann man sich vorstellen wie eine riesige Sammlung Klemmbausteine, die alle einzeln für sich alleine vorkommen, es gibt aber auch unendliche Möglichkeiten, sie zu kombinieren.

Sind freie Morpheme Wörter?
Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, ob „freies Morphem“ nicht einfach der Fachbegriff für „Wort“ ist. Und du hast recht, die Unterscheidung zwischen Morphem und Wort ist nicht immer leicht, da viele Morpheme gleichzeitig Morphem und Wort in einem sind. Allerdings ist der Begriff „Wort“ in der Linguistik unbrauchbar. Warum? Dazu habe ich bereits einen Beitrag geschrieben. Ich werde also nicht mehr von „Wörtern“ sprechen, sondern von Lexemen, um den Unterschied zwischen Wörtern/Lexemen und freien Morphemen zu erklären.
Dass die Unterscheidung zwischen zwei linguistischen Einheiten (freies Morphem und Lexem in diesem Fall) nicht immer leicht ist, kennt man auch von der Unterscheidung zwischen Silbe und Lexem. Oft sind Silben auch Lexeme (wie „Tisch“, eine Silbe, ein Lexem), aber halt nicht immer („Jacke“, zwei Silben, ein Lexem). Oft ist ein freies Morphem auch ein Lexem, aber nicht immer. Ein Lexem wie „Tischbein“ ist ein Lexem, besteht aber aus zwei freien Morphemen. „Tisch“ ist ein freies Morphem und „Bein“ ist ein freies Morphem, weil wir das Morphem „Bein“ auch frei in einem Satz wie: „Ich habe mir das Bein gebrochen“ verwenden können. Also, ohne dass es an das Morphem „Tisch“ gebunden werden muss. Freie Morpheme haben also immer die Möglichkeit, frei aufzutreten, können sich aber manchmal tarnen, indem sie sich trotzdem an ein anderes Morphem binden.
Welche freien Morpheme gibt es?
Neben freien Morphemen, die eine Wortbedeutung haben (kalt, Hund, spät) gibt es auch freie Morpheme, die eine grammatische „Bedeutung“ tragen. Ein Beispiel hierfür ist die Konjunktion „weil“. Sie hat keine Bedeutung wie „Tisch“ oder „Bein“, trägt aber eben eine eigene grammatische Funktion, eine grammatische Bedeutung, so zu sagen. Und da sind wir auch direkt beim Unterschied zwischen freien lexikalischen Morphemen und freien grammatischen Morphemen. Es gibt also freie Morpheme, die eine grammatische Bedeutung haben (die Konjunktion „weil“, außerdem die Artikel „der“, „die“, „das“ und Präpositionen wie „auf“) und freie Morpheme, die eine lexikalische (also Wort-) Funktion haben („prima“, „Tisch“).
Abgrenzung zu gebundenen Morphemen
Man unterscheidet freie und gebundene Morpheme.
Im Gegensatz zu den freien Morphemen stehen gebundene Morpheme wie Präfixe („un-“ in „unglücklich“) oder Suffixe („-keit“ in „Freundlichkeit“), die nicht allein stehen können.
Was sind gebundene Morpheme?
Gebundene Morpheme benötigen immer ein anderes Morphem, an das sich sich anhängen. Sie sind sozusagen die unsichtbaren Helfer, die Bedeutung und grammatische Informationen transportieren. Gebundene Morpheme (gefettet), sind zum Beispiel:
– „Tische“, „lachte“, „sagst“,
Sie sind nicht frei beweglich und können nicht alleine stehen. Das „–e“ von „Tische“ bedeutet „Plural“ und kann z. B. nicht einfach vor das Wort geschoben werden. Ihre Funktion ist es, ergänzende Informationen zu liefern. Sie sind also Bedeutungsträger, aber nur im Zusammenspiel mit anderen Morphemen.
Beispiele für gebundene Morpheme im Deutschen
Die Endung „-st“ in „trinkst“: Person und Zeit
Im Satz „Du trinkst zwei Flaschen Saft“ stehen zwei Morpheme:
- „trink-“: Das freie lexikalische Morphem mit der Bedeutung „trinken“.
- „-st“: Das gebundene grammatische Morphem, das die 2. Person Singular Präsens ausdrückt.
Die Endung „-n“ in „Flaschen“: Pluralbildung
Bei „Flaschen“ tragen wir Pluralinformation durch das gebundene Morphem „-n“.
Wortbildungsmorpheme wie „-ung“: Mehr als nur Grammatik
„Täuschung“, „Bebauung“: Das -ung-Suffix bildet Substantive aus Verben. Es ist gebunden, trägt aber keine grammatische, sondern wortbildende Funktion.
Gebundene lexikalische Morpheme: Das Beispiel „Him-“ in „Himbeere“
„Him-“ stammt vom mittelhochdeutschen „Hinde“ (Hirschkuh). Heute ist seine Bedeutung zwar kaum noch bekannt, doch es ist ein Beispiel für ein gebundenes lexikalisches Morphem.
Morpheme teilt man aber nicht nur in freie oder gebundene Morpheme ein, sondern man unterteilt sie noch weiter in lexikalische Morpheme und grammatische Morpheme.
Was sind lexikalische und grammatische Morpheme?
Bei lexikalischen Morphemen handelt es sich jeweils um das erste Morphem (gefettet) der Wörter:
– Tische, lachte, sagst
Das sind Morpheme, die eine Bedeutung tragen, etwas Reales (Konkretes oder Abstraktes) oder Vorgestelltes (Hexe oder Einhorn) ausdrücken.
Grammatische Morpheme (gefettet) sind jeweils der letzte Teil dieser Wörter:
– Tische, lachte, sagst.
Sie geben grammatische Kategorien an: Numerus, Tempus …
Man unterscheidet lexikalische und grammatische Morpheme.
Zusammenfassung
Morpheme sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten der Sprache. Ein Morphem trägt entweder eine Wortbedeutung (lexikalisches Morphem) oder eine grammatische Bedeutung (grammatisches Morphem). Morpheme teilt man in freie und gebundene Morpheme ein.
Nächster Beitrag
Was ist ein Wort?
Was ist ein Wort? Das ist doch eine völlig überflüssige Frage! Jeder weiß, was ein Wort ist. Oder?
Quellen
Spillmann, H. O. (2000): Einführung in die germanistische Linguistik. Langenscheidt.
Busch, A., & Stenschke, O. (2018). Germanistische Linguistik: eine Einführung. Narr Francke Attempto Verlag.
Dipper, S., Klabunde, R., & Mihatsch, W. (2018). Linguistik. Springer Berlin Heidelberg.
Vogel, P. (2010). Morphem. In E. Hentschel (Hrsg.), Deutsche Grammatik. Walter de Gruyter.