Fremdsprache als Superkraft: Wer zwei Sprachen spricht, hat bei Epilepsie einen entscheidenden Vorteil. Forscher zeigen, dass sich die zweite Sprache bei Betroffenen in die gesunde Hirnhälfte verlagert. Diese erstaunliche Fähigkeit zur Selbstrettung könnte nicht nur unser Verständnis von Mehrsprachigkeit verändern, sondern auch neue Wege in der Epilepsie‑Therapie eröffnen.
Als Quelle verwenden (APA)
Methling, R. (2025, 27. Juli). Bilingualismus: Wie eine Fremdsprache Epilepsie austrickst. https://www.linguistik.online. Abgerufen am XX.XX.20XX, von https://linguistik.online/bilingualismus-fremdsprache-epilepsie/
Dieser Artikel wurde am 27.07.2025 von Ralf Methling auf inhaltliche Korrektheit überprüft und aktualisiert.
Auf den Punkt gebracht
Eine neue Studie aus den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) bringt diese Erkenntnisse ans Licht:
- Die zweite Sprache (L2) bilingualer Menschen mit linksseitiger temporaler Epilepsie stützt sich stärker auf die gesunde Hirnseite. Es funktioniert wie ein System, das bei Gefahr (epileptische Aktivität) automatisch in einen Ersatzmodus schaltet.
- Für die Muttersprache (L1) gilt das kaum. Sie bleibt fester im Ursprungsnetzwerk verankert. Sie reagiert also unflexibler als die L2.
- Und das Erstaunliche: Je näher der Zeitpunkt des L2-Erwerbs am Beginn der Epilepsie liegt, desto stärker reorganisiert das Gehirn diese Sprachfunktion.
Quellenangabe zu diesen Fakten
A. Stasenko, E. Kaestner, A.J. Schadler, A. Reyes, C. Urbanic, J.L. Helm, D. Saldana, G. Carollo-Duprey, M. Połczyńska, C. Benjamin, L.N. Sepeta, T.H. Gollan, L. Cavanagh, & C.R. McDonald, Dynamic neuroplasticity of language networks: The intersection of bilingualism and epilepsy, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (29) e2422742122, https://doi.org/10.1073/pnas.2422742122 (2025).
Was passiert im Gehirn bei Epilepsie?
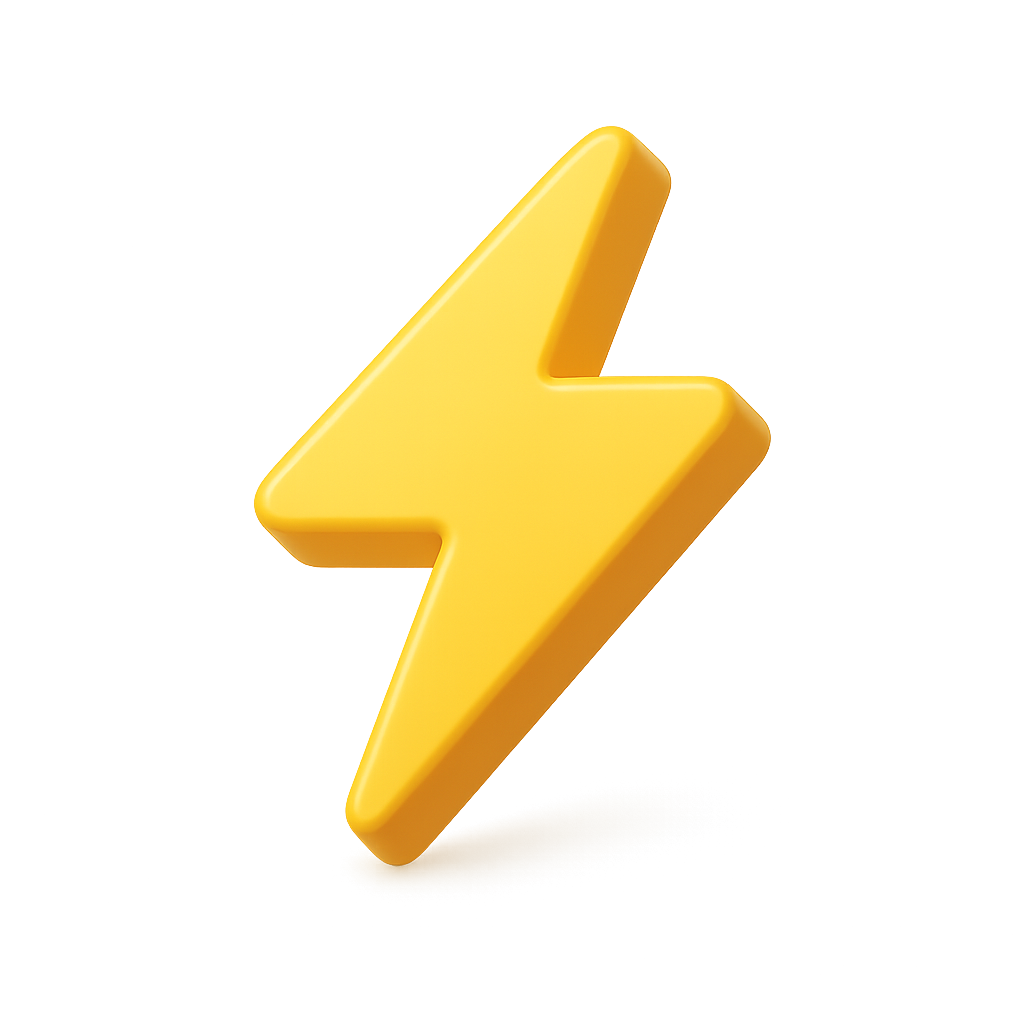
Epilepsie ist keine einheitliche Erkrankung, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene neurologische Störungen, die durch übermäßige neuronale Aktivität gekennzeichnet sind. Bei der temporalen Lappenepilepsie, der häufigsten Form bei Erwachsenen, entstehen die epileptischen Anfälle in den Schläfenlappen, also in Hirnarealen, die eng mit Gedächtnis und Sprache verknüpft sind.
Quellenbelege für diese Aussagen
World Health Organization. (2023). Epilepsy: Key facts. Retrieved July 26, 2025, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy
Engel, J. Jr. (2013). Approaches to refractory epilepsy. Epilepsia, 54(S2), 26–33. https://doi.org/10.1111/epi.12193
Folgen für die Sprache:
- Sprachstörungen während oder nach Anfällen
- Gedächtnisprobleme, die Wortfindung und Ausdrucksfähigkeit beeinträchtigen
- Risiko für dauerhafte Beeinträchtigungen, besonders bei häufigen Anfällen
Hier zeigt sich: Sprache ist verletzlich. Doch genau diese Verletzlichkeit macht die neuen Forschungsergebnisse so bedeutsam.
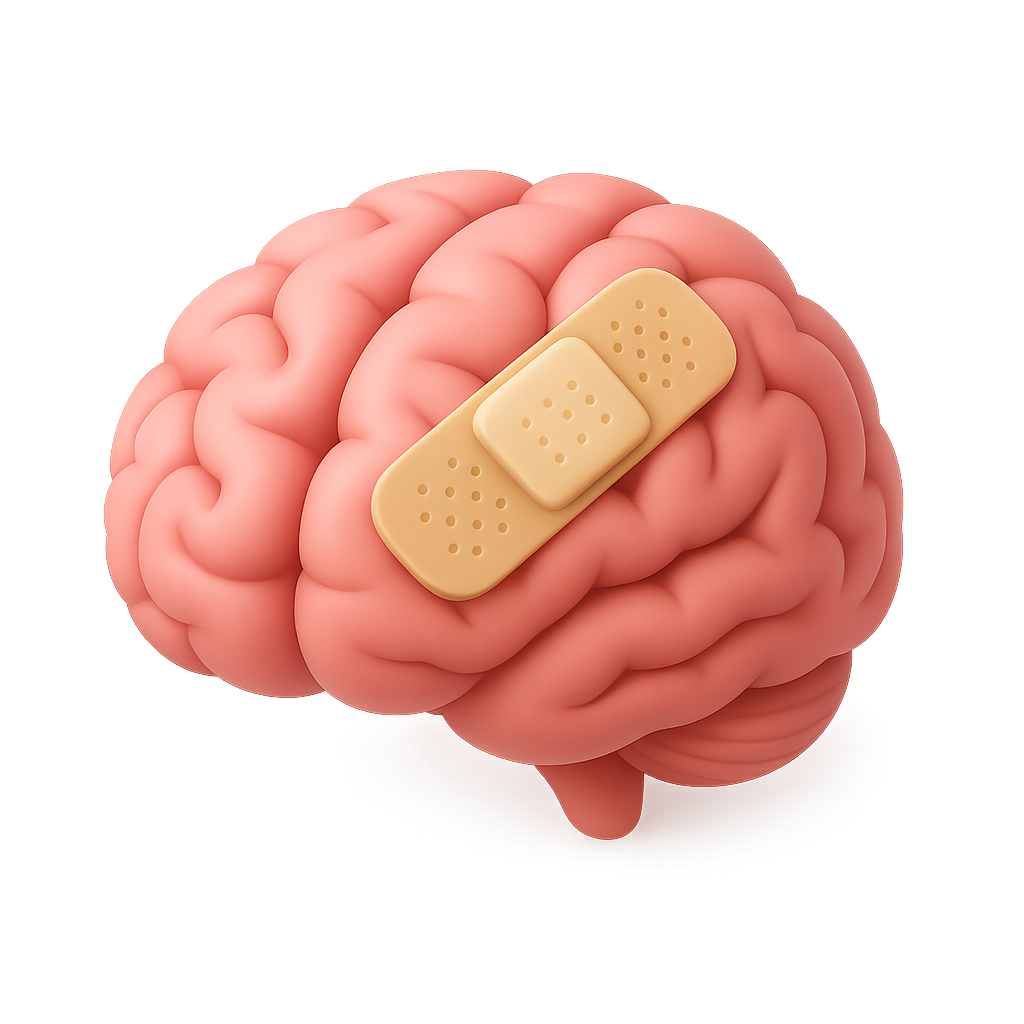
Quellenbelege für diese Aussagen
Höller, Y. & Trinka, E. (2014). What do temporal lobe epilepsy and progressive mild cognitive impairment have in common? Frontiers in Systems Neuroscience, 8, 58. https://doi.org/10.3389/fnsys.2014.00058
Zhao, F., Kang, H., You, L., Rastogi, P., Venkatesh, D., & Chandra, M. (2014). Neuropsychological deficits in temporal lobe epilepsy: A comprehensive review. Annals of Indian Academy of Neurology, 17(4), 374–382. https://doi.org/10.4103/0972-2327.144003
Bilingualismus und Gehirnplastizität
Wie das Gehirn mehrere Sprachen speichert
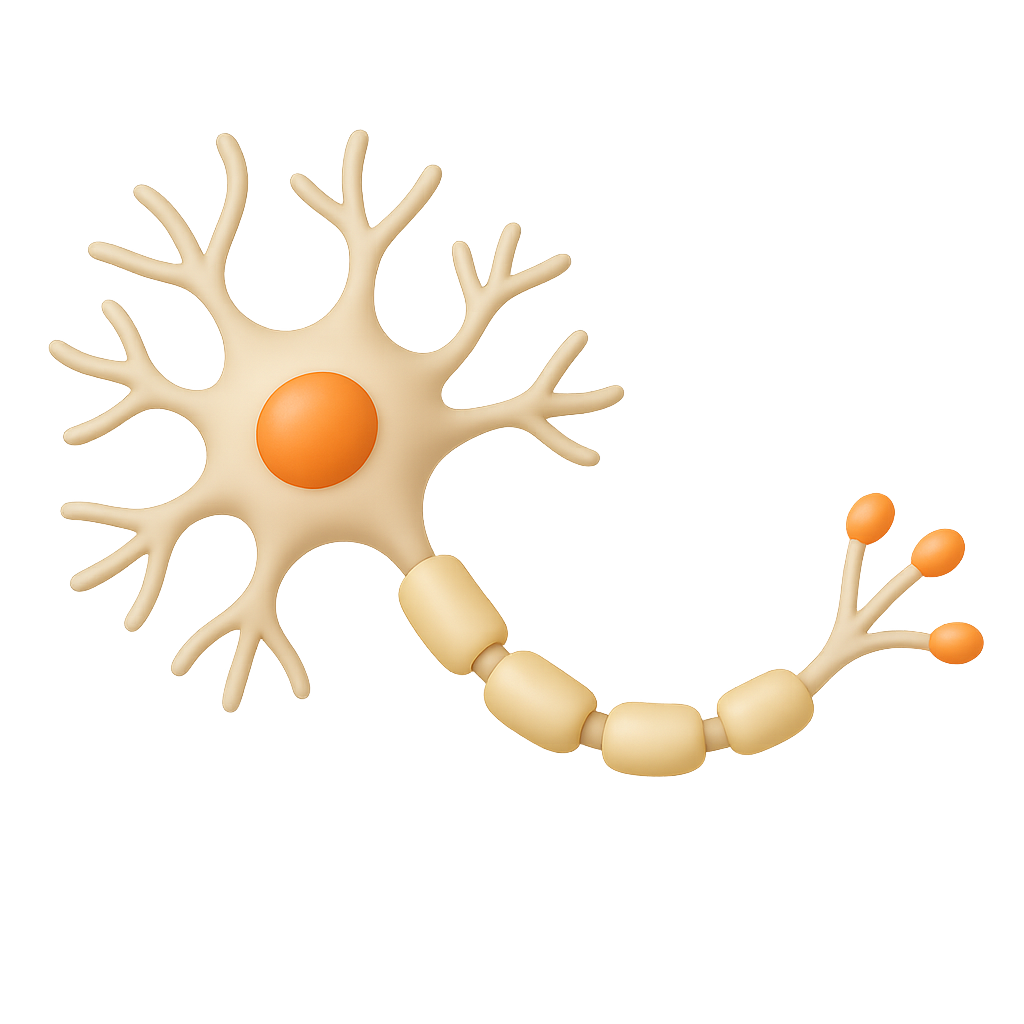
Das menschliche Gehirn ist ein wahres Meisterwerk der Anpassungsfähigkeit. Bilinguale und multilinguale Personen verfügen über komplexe neuronale Netzwerke, die verschiedene Sprachsysteme parallel verwalten. Dabei unterscheidet sich die Verarbeitung der Erstsprache (L1) von der Zweitsprache (L2) erheblich:
- Die L1 wird meist in früher Kindheit erworben und ist tief in den neuronalen Strukturen der linken Hemisphäre verankert.
- Die L2 hingegen wird oft später gelernt und nutzt teilweise andere Netzwerke, die sich flexibler anpassen können.
Die zweite Sprache wird häufig in zusätzlichen Netzwerken gespeichert, die weniger tief in den klassischen Spracharealen verankert sind.
Das macht sie beweglicher und damit besser verlagert, wenn Teile der linken Hemisphäre durch epileptische Aktivität beeinträchtigt werden.
Diese doppelte Repräsentation scheint das Gehirn widerstandsfähiger gegen Schäden zu machen. Wenn eine Region beeinträchtigt ist, kann eine andere die Funktion übernehmen. Dieses Prinzip konnte in der aktuellen Studie belegt werden.

Unterschiede in der Verarbeitung von L1 und L2
Die Unterschiede zwischen L1 und L2 gehen über die Frage, wo sie gespeichert weden, hinaus:
- L1 wird automatischer verarbeitet, benötigt weniger bewusste Kontrolle und ist stark mit emotionalen Gedächtnisinhalten verknüpft.
- L2 erfordert oft mehr kognitive Ressourcen und ist mit stärkerer Aktivierung präfrontaler Bereiche verbunden.
Die Forscher gehen davon aus, dass zusätzliche Aktivierungen in präfrontalen und parietalen Regionen entscheidend für diese Umorganisation sind.
Das Gehirn baut sich quasi ein Ausweichnetzwerk für die L2 auf – eine Art Sprach-Backup, von dem im Ernstfall profitiert werden kann.
Was heißt das für Epilepsie?
Die größere kognitive Anpassungsfähigkeit der L2 könnte erklären, warum das Gehirn sie bei neurologischem Stress eher in weniger betroffene Regionen reorganisiert. Genauso, wie es in der Studie bei linksseitiger Epilepsie beobachtet wurde.
Plastizität und kritische Lernphasen
Ein weiterer entscheidender Faktor ist das Alter beim Erwerb von L2.
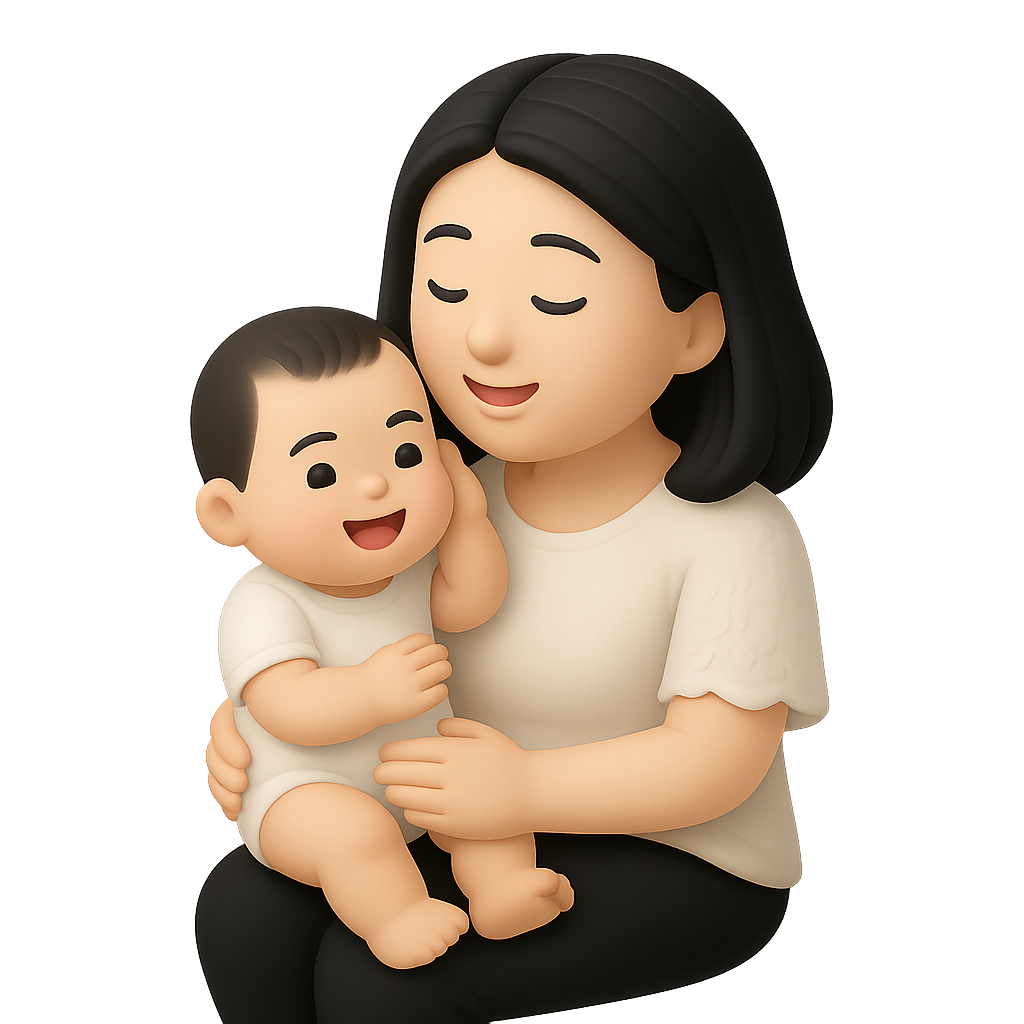
- Früh erlernte Sprachen (vor dem 6.–8. Lebensjahr) werden ähnlich wie L1 im linken Temporallappen verankert.
- Später erlernte Sprachen nutzen dagegen dynamischere Netzwerke und können bei Bedarf besser reorganisiert werden.
Die Studie bestätigt: Je näher der Zeitpunkt des L2-Erwerbs am Beginn der Epilepsie lag, desto stärker konnte das Gehirn diese Sprachfunktion in gesunde Bereiche verlagern. Das Gehirn reagiert besonders flexibel, wenn neurologischer Stress und Spracherwerb zeitlich eng beieinander liegen. Dieser „Timing-Effekt“ könnte erklären, warum Erwachsene, die kurz vor Epilepsiebeginn eine zweite Sprache gelernt haben, besonders stark von dieser Reorganisation profitieren.
Die PNAS-Studie im Detail
Teilnehmerzahl & Studiendesign
Die Forschenden untersuchten 70 Patienten mit temporaler Epilepsie:
- 24 bilingual,
- 46 monolingual.
Ziel war, zu analysieren, wie sich Sprachrepräsentationen bei Bilingualen im Vergleich zu Monolingualen verlagern.
fMRT-Analyse: Was wurde gemessen?
Mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) wurden Sprachaktivierungen während spezifischer Sprachaufgaben erfasst. So ließ sich nachvollziehen, wie die Aktivierung zwischen den Hemisphären verteilt wurde und ob es Unterschiede in der Verteilung zwischen den Hemisphären gab.
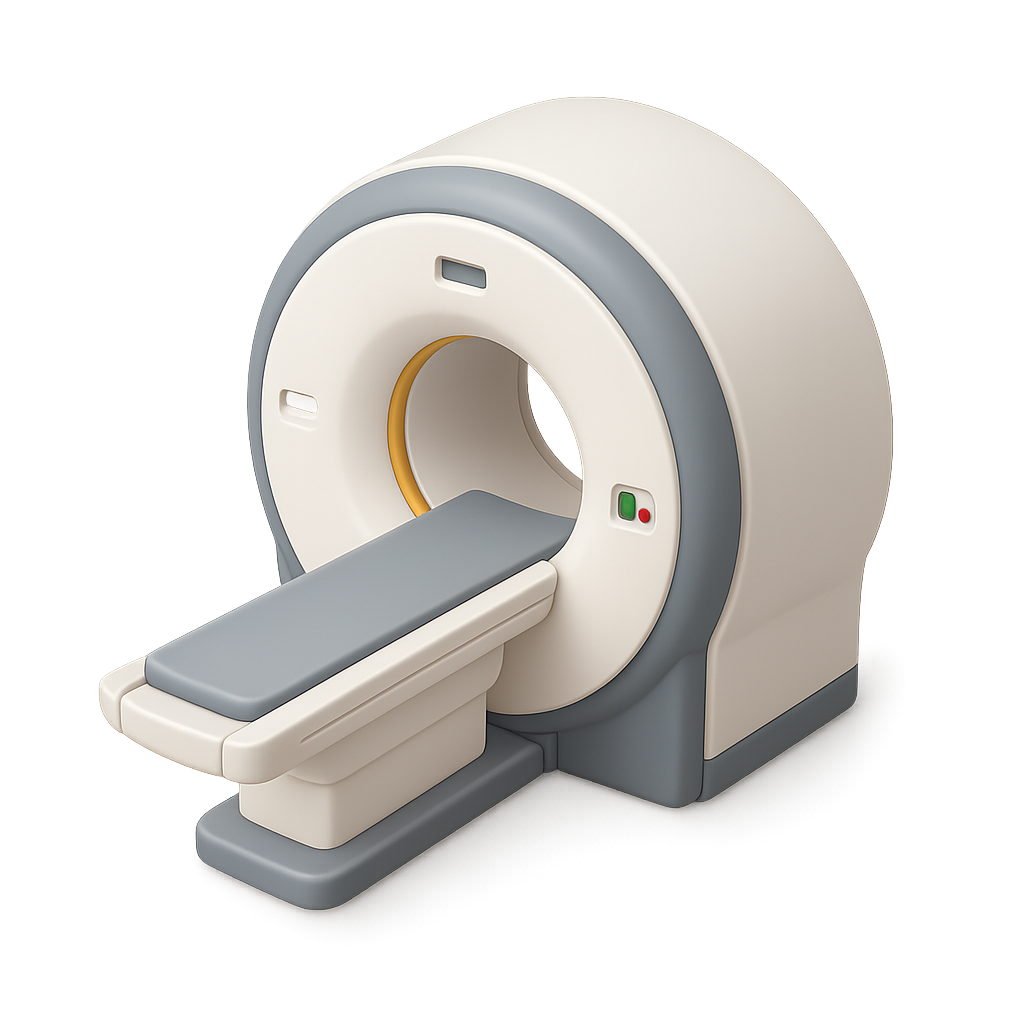
Praktische Konsequenzen für Medizin & Therapie
Die Erkenntnisse der Studie erweitern das Verständnis von Sprachplastizität bei Epilepsie und könnten langfristig auch klinische Überlegungen (etwa zur prächirurgischen Planung) beeinflussen.
1. Bilingualismus als neuroprotektiver Faktor
Die Ergebnisse deuten darauf hin: Mehrsprachigkeit geht mit einer flexibleren Organisation der Sprachnetzwerke einher, was dem Gehirn bei Epilepsie zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten eröffnet.
Die beobachtete Verlagerung von Aktivität der L2 in die gesunde Hemisphäre deutet auf einen kompensatorischen Mechanismus hin, der das Risiko von Sprachdefiziten möglicherweise beeinflussen könnte. Ob Bilingualismus hier langfristig einen kognitiven Vorteil bietet, muss jedoch noch untersucht werden.
2. Sprachenlernen als Rehabilitationsmaßnahme
Die Studie wirft die Frage nach einem ganz neuen Therapiekonzept auf:
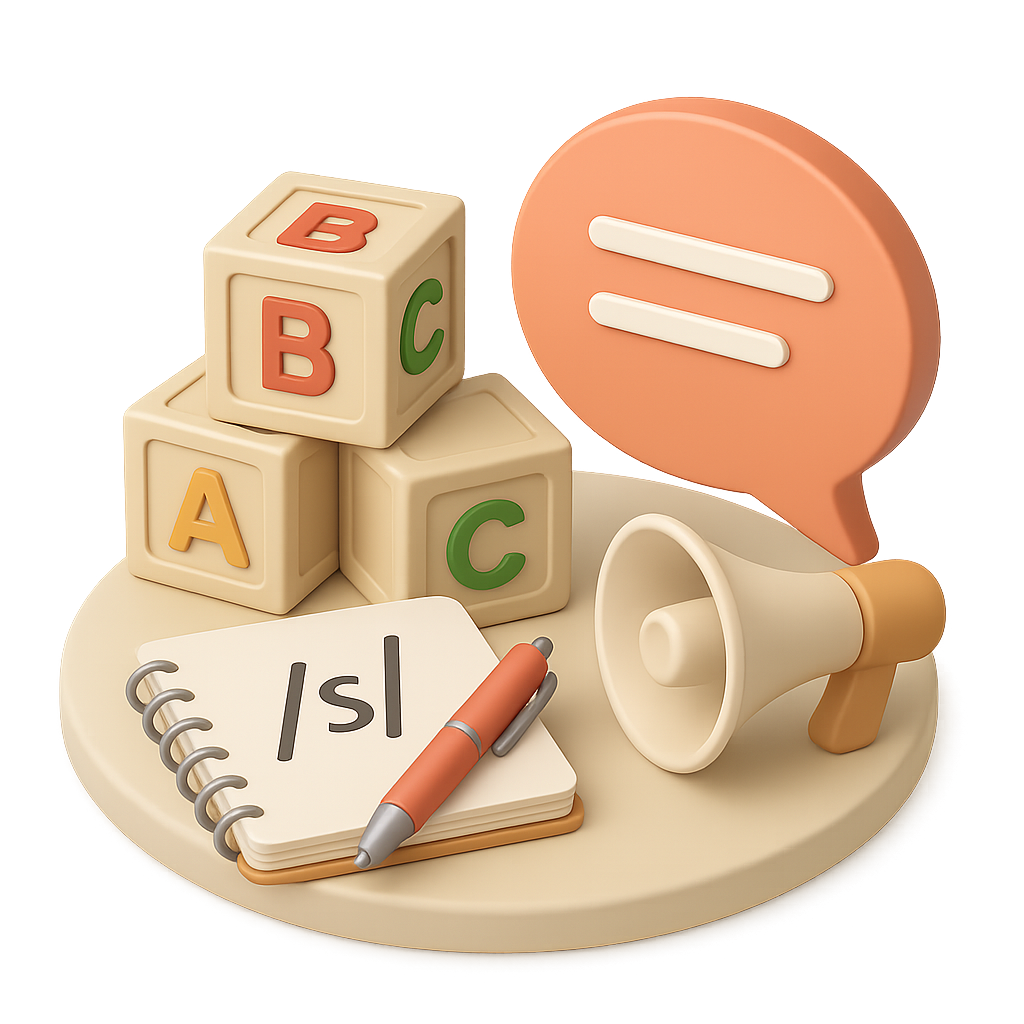
- Gezieltes Erlernen einer zweiten Sprache könnte als kognitive Therapie eingesetzt werden. Ähnlich wie physiotherapeutische Übungen nach einem Schlaganfall.
- Vor allem bei neu diagnostizierten Patienten könnte ein solches Training helfen, wichtige Sprachfunktionen in gesündere Hirnregionen zu verlagern.
3. Bedeutung für chirurgische Eingriffe
Epilepsiechirurgie ist oft notwendig, wenn Medikamente nicht mehr helfen. Doch Operationen im Sprachzentrum bergen das Risiko schwerer Defizite. Die Studie selbst betont vor allem die Relevanz ihrer Ergebnisse für die prächirurgische Planung. Darüber hinaus werfen die Befunde jedoch spannende Fragen für die Zukunft auf:
- Könnten Chirurgen die Erkenntnisse über die zweite Sprache gezielt nutzen, um wichtige Funktionen vor einem Eingriff in weniger gefährdete Hirnareale zu verschieben?
- Und könnte ein gezieltes Sprachtraining in einer zweiten Sprache nach der Operation helfen, verlorene Funktionen schneller zurückzugewinnen?

4. Kognitive Resilienz durch Mehrsprachigkeit
Mehrsprachigkeit wird schon lange mit kognitiver Reserve in Verbindung gebracht. Sie scheint als eine Art „Resilienzpolster“ gegen Demenz und andere neurologische Erkrankungen zu dienen. Die PNAS-Studie liefert jetzt einen weiteren klaren neurologischen Mechanismus für diesen Vorteil.
Quellenbelege für diese Aussagen
Bialystok, E., Craik, F. I. M., & Freedman, M. (2010). Delaying the onset of Alzheimer disease: bilingualism as a form of cognitive reserve. Neurology, 75(19), 1726–1729. https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181fc2a1c
Liu, H., & Wu, L. (2021). Lifelong bilingualism functions as an alternative intervention for cognitive reserve against Alzheimer’s disease. Frontiers in Psychiatry, 12, 696015. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.696015
Eventuell könnten Risikogruppen (z. B. Menschen mit erhöhter Epilepsie-Wahrscheinlichkeit) frühzeitig von gezieltem Sprachenlernen profitieren. So könnte Bilingualismus proaktiv als Schutzschild eingesetzt werden.
Grenzen der Studie & offene Fragen
So bahnbrechend die Ergebnisse sind, sie haben auch Grenzen:
- Kleine Stichprobe: Nur 24 bilinguale Patienten wurden untersucht. Das sind zu wenig, um endgültige Schlüsse zu ziehen.
- Heterogene Sprachhintergründe: Es wurden unterschiedliche Sprachen und Erwerbszeitpunkte einbezogen, was die Vergleichbarkeit erschwert.
- Keine Langzeitdaten: Noch ist unklar, wie stabil die Reorganisation der L2 über Jahre hinweg bleibt.
- Offene Mechanismen: Die genaue neuronale Verschaltung, die diese Verlagerung ermöglicht, ist noch nicht vollständig verstanden.
Offene Fragen:
- Wie beeinflusst die Sprachkompetenz (aktive vs. passive Beherrschung) die Reorganisation?
- Könnte intensives Sprachtraining gezielt eingesetzt werden, um die Verschiebung zu verstärken?
- Welche Rolle spielen weitere kognitive Faktoren wie Bildung, Beruf oder soziales Umfeld?
Zukunftsperspektiven – Der Wert von Bilingualismus
Die Ergebnisse der Studie deuten auf einen Wendepunkt hin: Bilingualismus ist nicht nur eine kulturelle Bereicherung, sondern könnte zu einem festen Bestandteil unseres Krankheitspräventionsmanagements werden. Immer mehr Studien zeigen, dass das Erlernen einer weiteren Sprache einen wichtigen Beitrag zu einem gesünderen Leben leisten kann – ähnlich wie Sport.
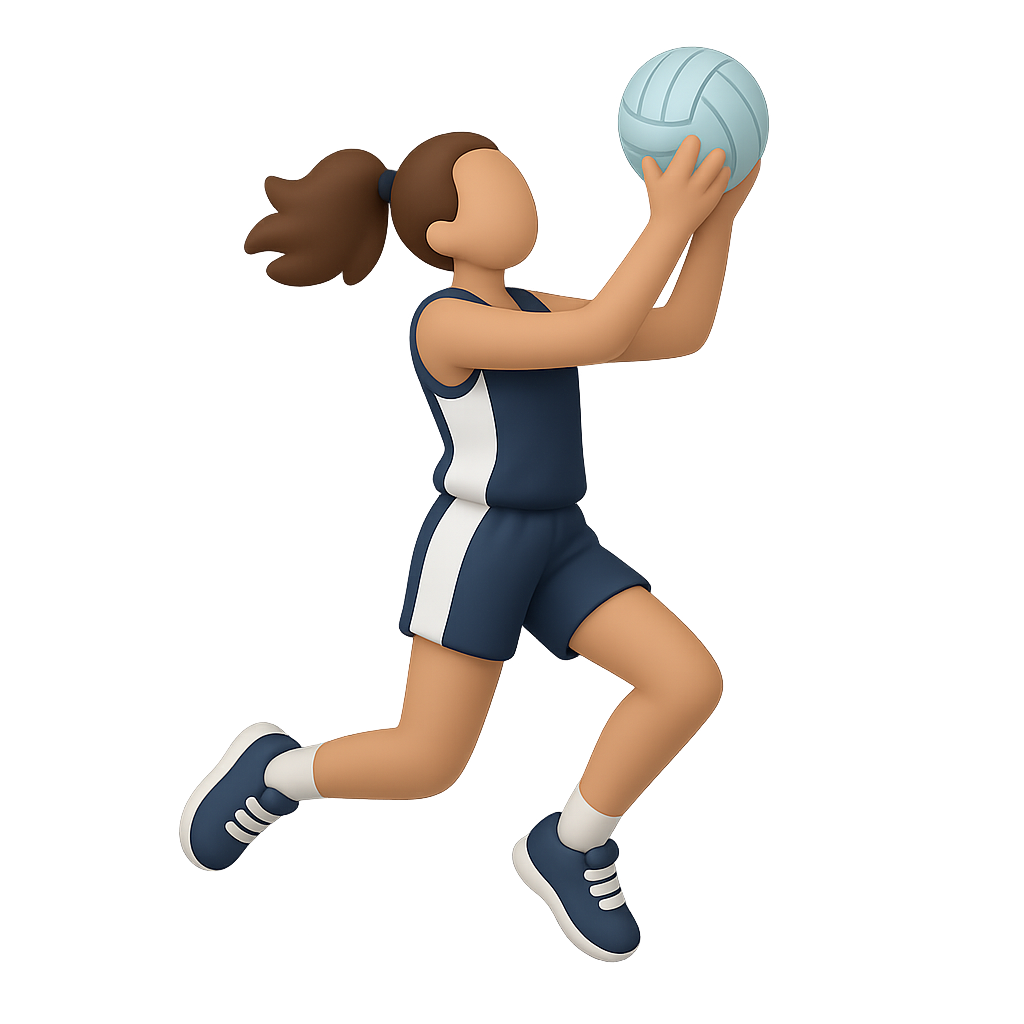
FAQ: Bilingualismus und Epilepsie
Was genau wurde in der Studie untersucht?
Die Forschenden analysierten mit fMRT, wie sich Sprachrepräsentationen bei 24 bilingualen und 46 monolingualen Epilepsiepatienten in den Gehirnhemisphären verteilen.
Was ist der wichtigste Unterschied zwischen L1 und L2 bei Epilepsie?
L2 ist flexibler und kann bei Bedarf in die gesunde Hemisphäre verlagert werden, während L1 stärker in der ursprünglichen Region verbleibt.
Bedeutet Bilingualismus automatisch Schutz vor Sprachverlust?
Nein, aber er erhöht vermutlich die Chancen, Sprachfunktionen trotz epileptischer Schädigungen zu erhalten.
Hilft auch das Erlernen einer Sprache im Erwachsenenalter?
Ja – besonders wenn der Erwerb zeitnah zum Beginn der Epilepsie erfolgt.
Kann gezieltes Sprachtraining als Therapie verschrieben werden?
Das ist derzeit noch nicht Standard, könnte aber in Zukunft ein Bestandteil personalisierter Epilepsiebehandlung werden.
Welche Sprachen eignen sich besonders?
Die Studie macht keine Unterschiede zwischen Sprachen. Entscheidend sind Intensität und aktiver Gebrauch der neuen Sprache.
Gilt der Effekt nur für temporale Epilepsie?
Die Studie untersuchte explizit Patienten mit Temporallappenepilepsie. Ob die Ergebnisse auf andere Formen übertragbar sind, ist noch unklar.
Kann man Bilingualismus auch nach der Operation therapeutisch nutzen?
Denkbar wäre, dass gezieltes Sprachtraining hilft, Sprachfunktionen nach chirurgischen Eingriffen schneller wiederherzustellen.
Welche Rolle spielt die kulturelle Einbettung beim L2-Erwerb?
Starke emotionale und soziale Verknüpfungen fördern die Verankerung der Sprache im Gehirn und könnten die Reorganisation zusätzlich unterstützen.

