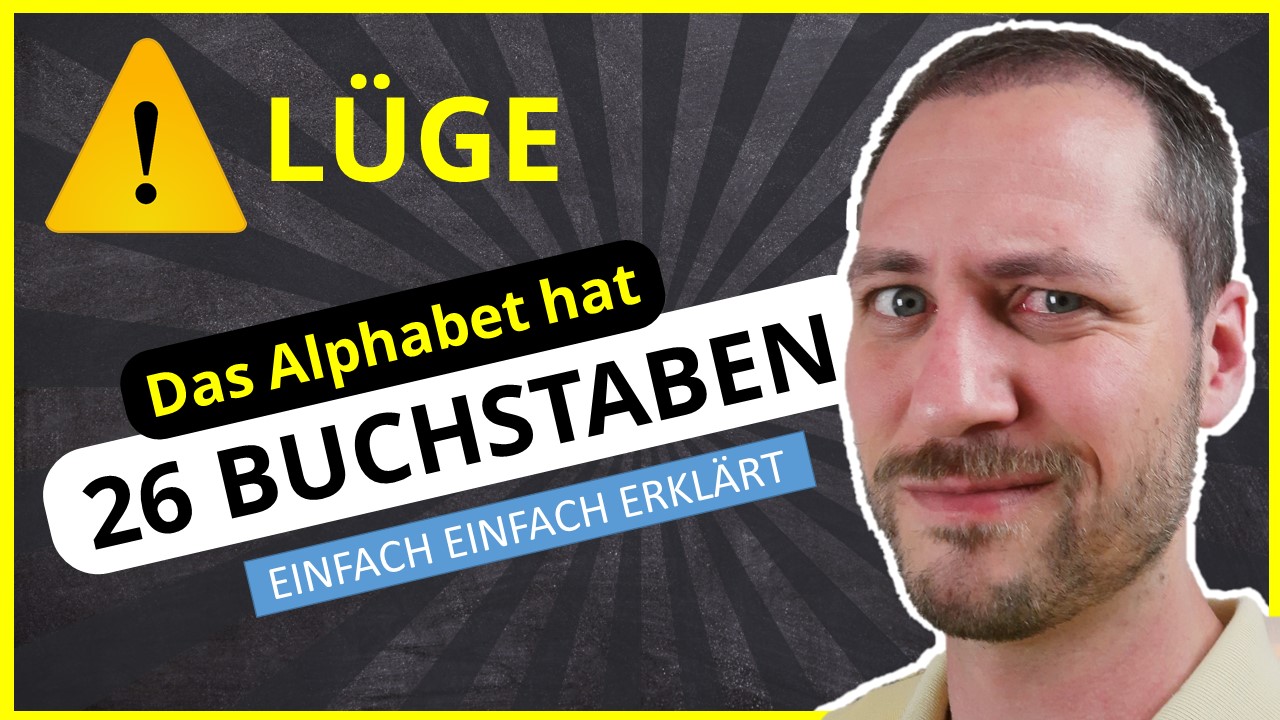Dank der Erfindung der Schrift können wir Menschen nicht nur sprechen, sondern auch schreiben. Die Wissenschaft der Schrift ist die Graphematik. Sie bietet uns ein tiefes Verständnis der Schrift als eigenständiges System zur Kommunikation.
Als Quelle verwenden (APA)
Methling, R. (2025, 31. Juli). Graphematik: Grundlagen, Konzepte und Bedeutung für die Sprachwissenschaft. https://www.linguistik.online. Abgerufen am XX.XX.20XX, von https://linguistik.online/was-ist-graphematik/
Dieser Artikel wurde am 31.07.2025 von Ralf Methling auf inhaltliche Korrektheit überprüft und aktualisiert.
Was ist Graphematik?
Die Graphematik ist ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft, das sich mit Schriftsystemen und deren Strukturen befasst. Sie untersucht, wie Sprache schriftlich abgebildet wird und welche Regeln, Prinzipien und Funktionen dabei zum Tragen kommen. Während die Phonologie den Lauten und deren Systematik gewidmet ist, übernimmt die Graphematik dieselbe Aufgabe für die geschriebene Sprache.

Graphematik vs. Orthographie
Im Gegensatz zur Orthographie, die vorschreibt, wie etwas „korrekt“ geschrieben wird, nimmt die Graphematik eine deskriptive (beschreibende) Perspektive ein. Sie beschreibt tatsächlich vorkommende Schreibungen und analysiert, warum diese sich etabliert haben.
Beispiel:
Man könnte das Wort Käse unterschiedlich schreiben: Kese, Kähse, Kehse… . Das ist der Bereich der Graphematik. Alle Schreibungen sind plausibel und kommen sicherlich auch vor.
Die Orthographie entscheidet dahingegen, dass es nur eine richtige Schreibung gibt: Käse. Sie wertet und schreibt vor (präskriptiv).

Graphetik vs. Graphematik: Zwei Seiten derselben Medaille
Um die Graphematik vollständig zu verstehen, ist es wichtig, sie zudem von der Graphetik abzugrenzen:
- Graphetik untersucht die materielle und visuelle Gestaltung von Schrift. Dazu gehören Schriftarten, Schriftgrößen, gedruckte und handgeschriebene Schrift, persönliche und gesellschaftliche Schreibstile, die Entwicklung der Schrift im Laufe der Geschichte sowie kalligraphische und typografische Standards. Sie betrachtet die visuelle Sprachkommunikation als Teilbereich menschlicher Kommunikation und analysiert, wie graphische Systeme (z. B. Alphabete) als Repräsentation von Lautsprache funktionieren.
- Graphematik hingegen befasst sich mit der abstrakten Ebene der Schrift: Welche Zeichen bilden die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten (Grapheme)? Wie interagieren sie innerhalb des Schriftsystems?
👉 Kurz gesagt:
Graphetik fragt: Wie sieht ein <A> aus? Ist es Buchstabe, Satzzeichen, Sonderzeichen oder Ligatur?
Graphematik fragt: Welche Funktion hat das Graphem <a> im Schriftsystem des Deutschen?

Graphe, Grapheme, Phone & Phoneme
In der Graphematik ist es zudem wichtig, zwischen Graphen, Graphemen, Phonen und Phonemen zu unterscheiden. Buchstaben, Grapheme, Phone und Phoneme sind keine Synonyme. Man unterscheidet sie:
- Graphen sind die konkreten Schriftzeichen, also die sichtbaren Buchstabenformen, aus denen ein Wort besteht. So hat das Wort Tasche sechs Buchstaben (Graphen) und Quatsch sieben.
- Grapheme hingegen sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Schrift. In Tasche gibt es vier Grapheme (<t>, <a>, <sch>, <e>), in Quatsch ebenfalls vier (<qu>, <a>, <t>, <sch>).
- Phone bezeichnen die konkreten Laute, die beim Sprechen hervorgebracht werden (z. B. [t], [a], [ʃ] [ə]). Tasche enthält vier Phone, Quatsch enthält fünf.
- Phoneme stellen die abstrakten, bedeutungsunterscheidenden Laute einer Sprache. So lassen sich in Tasche (/t/, /a/, /ʃ/ /ə/) und Quatsch (/k/ /v/ /a/ /t/ /ʃ/) jeweils vier bzw. fünf Phoneme identifizieren.
| Graphetik | Graphematik | Phonetik | Phonologie | |
|---|---|---|---|---|
| Medium | visuelle Muster | visuelle Muster | Schallwellen | Schallwellen |
| Grundeinheit | Graph/Buchstabe | Graphem | Phon/Laut | Phonem |
| Notation | <…> | <…> | […] | […] |
| in den Worten de Saussures | Parole | Langue | Parole | Langue |
Wie man Grapheme findet
Um Grapheme zu identifizieren, wird in der Graphematik häufig die Minimalpaaranalyse verwendet. Dieses Verfahren stammt ursprünglich aus der Phonologie. Das Prinzip ist einfach: Man nimmt ein Wort und tauscht ein Element aus, das man für ein Graphem hält, und überprüft, ob sich dadurch die Bedeutung des Wortes verändert. Wichtig ist, dass sich die beiden Wörter nur in diesem einen Element unterscheiden und sie die gleiche Anzahl Grapheme haben. So lässt sich feststellen, ob das Element tatsächlich ein eigenständiges Graphem ist.
Ein Beispiel ist das Wort Tasche: Ersetzt man das Anfangsgraphem <t> durch <l>, <m>, <n>, entstehen neue Wörter:
- Lasche,
- Masche,
- (ich) nasche.
Es sind alles eigenständige Wörter mit einer anderen Bedeutung. Dies beweist, dass <t>, <l>, <m> und <n> Grapheme ist. Sie unterscheiden im Deutschen Bedeutungen. Dabei können Grapheme sowohl aus einem einzelnen Buchstaben bestehen (z. B. <l>) als auch aus mehreren Buchstaben (z. B. <sch> als Mehrgraph).
3 besondere Fakten über Minimalpaare im Deutschen
- Im Deutschen gibt es einige besondere Grapheme, die nicht aus einem einzelnen Buchstaben bestehen. So bilden Digraphen wie <ch> (z. B. Bach) und <ie> (z. B. Liebe) sowie der Trigraph <sch> (z. B. Schule) jeweils ein einzelnes Graphem, obwohl sie aus zwei bzw. drei Buchstaben bestehen. Das erkennt man gut an Minimalpaaren, also Wortpaaren, die sich nur in genau einem Graphem unterscheiden. Ein Beispiel hierfür ist Schade. Ersetzt man <sch> durch <l>, entsteht Lade; beide Wörter unterscheiden sich nur in diesem einen Graphem.
- Besonders interessant sind auch Diphthong-Schreibungen wie <ei>, <au> und <eu>. Diese gelten nicht als einzelne Grapheme, sondern als Kombinationen von Vokalgraphemen. Das zeigt sich an Minimalpaaren wie Feier und Feuer: Hier verändern sich die Laute deutlich, obwohl die Schreibung nur geringfügig abweicht. Solche Beispiele verdeutlichen, dass nicht jede mehrbuchstabige Kombination ein eigenes Graphem bildet. Entscheidend ist die bedeutungsunterscheidende Funktion im Schriftsystem.
- Darüber hinaus gibt es im deutschen Schriftsystem Buchstaben, die nicht zu den regulären Graphemen zählen: <c>, <q>, <v>, <x> und <y>. Sie treten vor allem in Fremdwörtern, Lehnwörtern (z. B. Quiz, Taxi, Yoga) oder Eigennamen (Casper) auf und sind im Kernwortschatz des Deutschen eher selten. Damit bilden sie keine eigenständigen Grapheme des deutschen Grundbestandes, sondern werden vor allem als orthographische Marker für nicht-deutsche oder historische Herkunft wahrgenommen.
Alle Grapheme des Deutschen
Das deutsche Graphem-Inventar besteht aus den folgenden Graphemen:
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | w | z | ä | ö | ü | ß | ie | qu | ch | sch |
Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK)
In Alphabetschriften wie dem Deutschen besteht eine enge Verbindung zwischen Graphemen (Schriftzeichen) und Phonemen (bedeutungsunterscheidenden Lauten). Diese Beziehung nennt man Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK).
So entspricht das Graphem <p> in der Regel dem Phonem /p/. Doch diese Zuordnung ist nicht immer eindeutig: Unterschiedliche Grapheme wie <f> (faul), <ff> (hoffen), <v> (Vogel) und <ph> (Phase) repräsentieren alle dasselbe Phonem /f/. Umgekehrt kann auch ein einzelnes Graphem mehrere Phoneme repräsentieren – etwa <e> in den Wörtern Bett (/ɛ/), gehen (/eː/) und bitte (/ə/).
Um zu erklären, welche Grapheme welchen Phonemen zugeordnet werden, bedient sich die Graphematik Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln. Diese Regeln beschreiben systematisch, wie Laute in der Schrift abgebildet werden und umgekehrt. Dabei handelt es sich nicht um starre 1:1-Zuordnungen, sondern um erlernte Muster, die wir im Laufe des Spracherwerbs internalisieren.
Beispiel:
Das Graphem <qu> in Quatsch besteht zwar aus zwei Buchstaben, repräsentiert aber die Lautfolge /k/ und /v/, also zwei Phoneme. Dieses Wissen erwerben Grundschulkinder. Es ist eine Graphem-Phonem-Korrespondenz.
Allographe in der Graphematik
Ebenso wie in der Phonologie Allophone als lautliche Varianten eines Phonems existieren, gibt es in der Graphematik Allographe: unterschiedliche Darstellungen desselben Graphems. Dazu zählen typografische Varianten (z. B. ein <a> in Druck- oder Handschrift), Groß- und Kleinschreibung sowie orthographische Alternativen (z. B. <ph> und <f> in Philosophie und Filosofie).
Historische Entwicklung der Graphematik
Ein wichtiger Unterschied zur gesprochenen Sprache: Schrift kann nicht spontan entstehen wie Sprache. Sie ist ein kulturelles Artefakt, das über Jahrtausende entwickelt wurde und bis heute ständigen Veränderungen unterliegt.
Lange Zeit galt die Schrift lediglich als Abbild der gesprochenen Sprache. Diese Sichtweise wird als Dependenzhypothese bezeichnet. Sie stützt sich auf mehrere Argumente:
- Phylogenetisch betrachtet entwickelte sich die Schrift in der Menschheitsgeschichte erst sehr spät und immer auf der Grundlage bereits existierender gesprochener Sprache.
- Ontogenetisch zeigt sich ein ähnliches Muster: Jedes Individuum lernt zunächst sprechen und erst später lesen und schreiben.
- Funktional spielt die gesprochene Sprache eine deutlich größere Rolle im Alltag, da Menschen wesentlich mehr Gesprochenes als Geschriebenes produzieren und konsumieren.
- Strukturell gilt: Sprache kann auch ohne Schrift existieren, wie viele mündliche Kulturen zeigen, während Schrift ohne Sprache nicht möglich wäre.
Diese Argumente verdeutlichen, warum die Schrift lange als sekundär und abhängig von der gesprochenen Sprache angesehen wurde.
Doch mit dem Aufkommen der Autonomiehypothese in den 1970er Jahren setzte sich zunehmend die Ansicht durch: Schrift ist ein eigenständiges linguistisches System. Sie erfüllt nicht nur die Funktion, gesprochene Sprache zu fixieren, sondern bietet eigene Ausdrucksmöglichkeiten (z. B. Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion).

Schriftsysteme im Überblick

Alphabetschriften
In Alphabetschriften (z. B. Lateinisch, Griechisch) repräsentiert jedes Graphem typischerweise einen Laut. Dies ist das in Europa dominierende Schriftsystem.
Silbenschriften
In Silbenschriften steht jedes Zeichen für eine Silbe. Beispiele:
- Katakana und Hiragana im Japanischen,
- Chereokee (Sprache der Cherokee Nation).
ユメ
Japanisches Wort für „Traum“
Logographische Schriftsysteme
Hier repräsentiert jedes Zeichen ein Morphem oder ein ganzes Wort. Beispiel:
- Chinesische Schriftzeichen.
夢
chinesisches Schriftzeichen für „Traum“
Schreibrichtung und kulturelle Unterschiede
Die Schreibrichtung ist ein kulturell geprägtes Merkmal:
- Links nach rechts: Lateinisch, Griechisch, Kyrillisch.
- Rechts nach links: Arabisch, Hebräisch.
- Vertikal: Traditionelles Chinesisch oder Japanisch.
Diese Unterschiede sind nicht nur ästhetisch, sondern beeinflussen auch das Layout von Texten und die Leserichtung.
FAQ zur Graphematik
Was ist der Unterschied zwischen Graphem und Buchstabe?
Ein Graphem ist eine abstrakte bedeutungsunterscheidende Einheit, während ein Buchstabe nur eine grafische Repräsentation ist.
Was sind Allographe?
Das sind Varianten eines Graphems, z. B. verschiedene Schriftarten, Groß- und Kleinschreibung oder Handschriftformen.
Warum ist die Graphematik wichtig?
Sie hilft uns, Schriftsysteme zu verstehen, Orthographieregeln zu analysieren und Schriftgebrauch zu optimieren.
Was bedeutet Dependenzhypothese?
Die Annahme, dass Schrift lediglich ein Abbild der gesprochenen Sprache sei.
Was ist der Unterschied zwischen Alphabetschrift, Silbenschrift und logographischer Schrift?
Alphabetschrift ordnet Zeichen Lauten zu, Silbenschrift ordnet Zeichen Silben zu, logographische Schrift ordnet Zeichen ganzen Wörtern oder Morphemen zu.
Warum ist die Großschreibung im Deutschen besonders?
Weil Substantive auch innerhalb von Sätzen großgeschrieben werden – ein Merkmal, das die Textstruktur verbessert.
Quellen
Althaus, H. P. (1980). 11. Graphetik. In H. P. Althaus, H. Henne & H. E. Wiegand (Hrsg.), Lexikon der Germanistischen Linguistik (2., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, S. 138–142). Berlin & New York: Max Niemeyer Verlag.
Burton, S., Dechaine, R.-M., & Vatikiotis-Bateson, E. (2012). Linguistics for dummies. Hoboken, NJ: Wiley Publishing.
Dipper, L. (2018). Linguistik: Eine Einführung (nicht nur) für Germanisten, Romanisten und Anglisten. Stuttgart: J.B. Metzler.
Methling, R. (2024). Germanistische Linguistik für Dummies. Wiley-VCH
Schlobinski, P. (2010). Grundfragen der Linguistik: Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler.