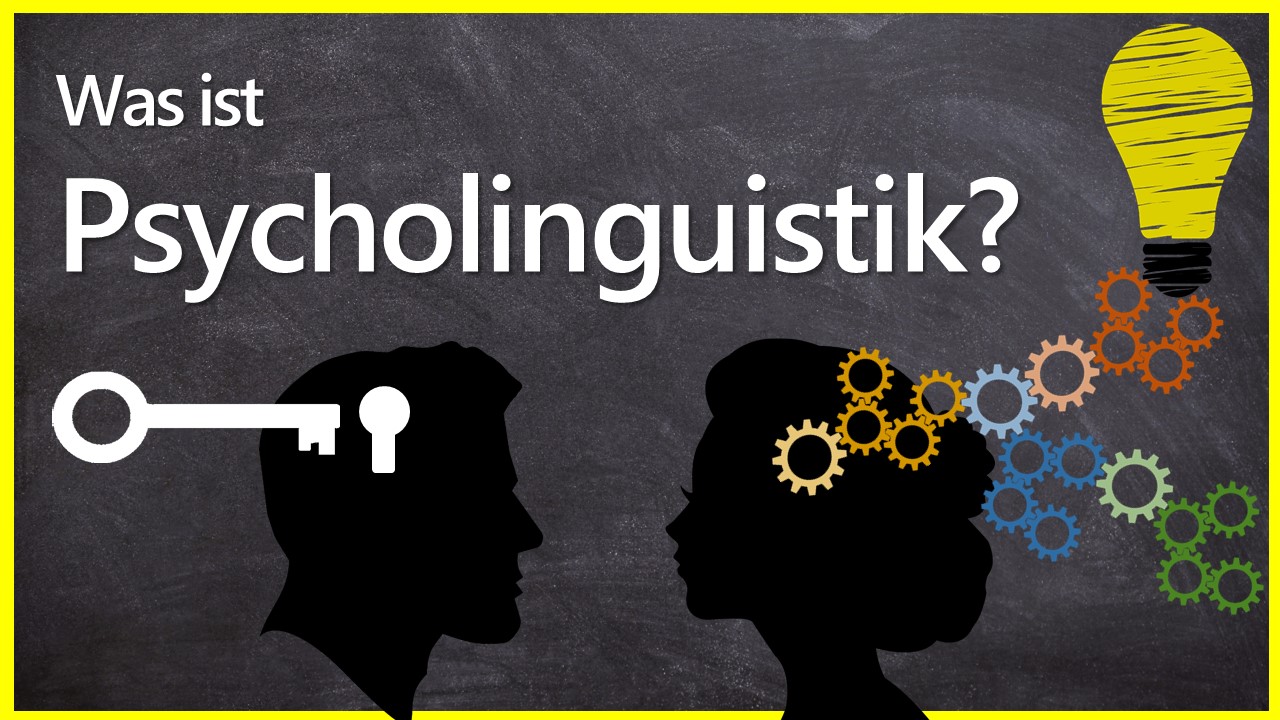Die Universalgrammatik ist eine der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Theorien der modernen Linguistik. Sie geht auf den US-amerikanischen Sprachwissenschaftler Noam Chomsky zurück, der in den 1950er- und 1960er-Jahren eine radikale neue Sichtweise auf Sprache einführte. Sein Ansatz stellte die damals vorherrschende behavioristische Sichtweise, dass Sprache lediglich durch Imitation erlernt werde, grundlegend infrage. Doch was genau bedeutet Universalgrammatik? Und warum hat diese Theorie die Sprachwissenschaft nachhaltig verändert?
Als Quelle verwenden (APA)
Methling, R. (2025, 28. Juli). Universalgrammatik – Die revolutionäre Theorie von Noam Chomsky. https://www.linguistik.online. Abgerufen am XX.XX.20XX, von https://linguistik.online/universalgrammatik/
Dieser Artikel wurde am 28.07.2025 von Ralf Methling auf inhaltliche Korrektheit überprüft und aktualisiert.
Was ist Universalgrammatik?
Der Begriff „Universalgrammatik“ (engl. universal grammar) beschreibt laut Chomsky eine angeborene mentale Struktur, die allen Menschen gemeinsam ist und die den Erwerb jeder menschlichen Sprache ermöglicht.
Chomskys Definition
Chomskys Ziel war es nicht, nur einzelne Sprachen zu beschreiben, sondern eine Grammatik zu entwerfen, die für alle Sprachen gilt. Die Universalgrammatik ist ein kognitiver Bauplan. Sie erklärt, warum Menschen jede Sprache lernen können. Dabei ist es irrelevant, in welchem kulturellen Kontext sie aufwachsen.
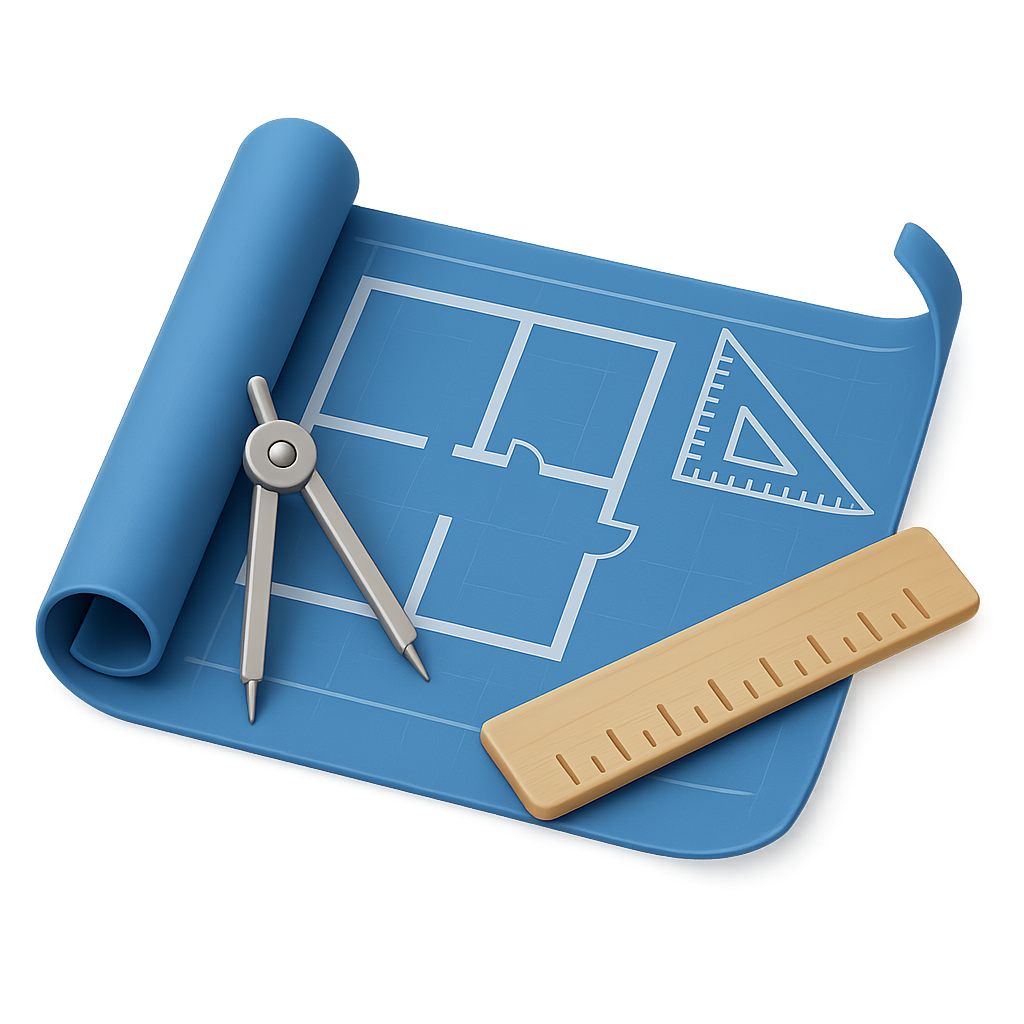
Die große Frage: Wie lernen Kinder Sprache?
Der Ausgangspunkt von Chomskys Theorie war die Frage: Wie können Kinder so schnell und fehlerfrei komplexe Sprachstrukturen erlernen? Natürlich spielt Nachahmung eine große Rolle. Kinder hören ihre Bezugspersonen sprechen und versuchen, diese nachzuahmen.
Warum Nachahmung nicht reicht

Doch Chomsky wies darauf hin, dass Kinder Sätze bilden, die sie nie zuvor gehört haben. Sie produzieren sowohl korrekte als auch fehlerhafte Äußerungen. Beispiel: Ein Kind sagt zunächst korrekt ich las, später aber ich leste, bevor es schließlich wieder zur korrekten Form zurückkehrt. Das zeigt: Kinder wenden abstrakte Regeln an, nicht nur bloßes Imitieren.
Sprachproduktion ist potenziell unendlich variabel. Kein Kind könnte alle möglichen Sätze durch bloßes Hören erlernen. Daraus folgt: Es muss angeborenes Wissen über Sprache geben.
Die Idee eines angeborenen Sprachmoduls
Chomsky postulierte das Language Acquisition Device (LAD): ein biologisches Modul im Gehirn, das den Spracherwerb ermöglicht. Alle Sprachen teilen grundlegende Strukturen. Die Unterschiede entstehen durch Parameter, die beim Spracherwerb „eingestellt“ werden. Vergleiche das mit Schaltern, die je nach Sprache aktiviert werden.

Prinzipien und Parameter
Beispiel 1: Subjektpflicht und Nullsubjekt-Sprachen
Im Deutschen ist ein Subjekt fast immer notwendig (Es regnet). In Sprachen wie Italienisch kann es entfallen (Piove).
Beispiel 2: Wortstellung und Sprachtypologie
Sprachen unterscheiden sich auch durch ihre Wortstellung. Englisch ist z. B. eine SVO-Sprache (Subjekt-Verb-Objekt), während Persisch eine SOV-Sprache ist. Chomsky sah darin universelle Prinzipien mit variablen Parametern.
Beleg für diese Aussagen
Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) 2013.
WALS Online (v2020.4) [Data set]. Zenodo.
https://doi.org/10.5281/zenodo.13950591
(Available online at https://wals.info, Accessed on 2025-07-28.)
Rekursion – Der Kern der Universalgrammatik
2002 reduzierte Chomsky die Universalgrammatik auf ein einziges zentrales Prinzip: Rekursion. Rekursion erlaubt es, Sätze ineinander zu verschachteln (Ich denke, dass du glaubst, dass er weiß…). Damit lassen sich mit begrenzten Regeln unendlich viele Sätze bilden.
Rekursion als zentrales Merkmal
Noam Chomsky, Marc Hauser und W. Tecumseh Fitch unterteilen die Universalgrammatik in zwei Teile:
- die sprachliche Fakultät im weiten Sinn (FLB) und
- die sprachliche Fakultät im engen Sinn (FLN).
Sie argumentierten, dass die FLN ausschließlich die Fähigkeit zur Rekursion umfasst (das Einfügen von Strukturen in Strukturen). Diese Fähigkeit sei einzigartig menschlich.
Die Autoren betonen, dass die FLN womöglich nicht speziell für Kommunikation, sondern zunächst für andere kognitive Zwecke wie Navigation, Zahlenverarbeitung oder soziale Interaktionen entstanden sein könnte. Später sei sie dann für Sprache „umgewidmet“ worden. Diesen Prozess bezeichnet man Exaptation. Diese Sichtweise eröffnet neue Perspektiven auf die biologische Evolution von Sprache und stellt die These auf, dass nur das rekursive Element, nicht jedoch das gesamte Sprachsystem, ein einzigartiges menschliches Merkmal sei.
Das Minimalistische Programm
Der Artikel von Hauser et al. legte zudem einen entscheidenden Grundstein für das sogenannte Minimalistische Programm Chomskys: Die Idee, dass das Sprachsystem ein optimales kognitives Rechensystem ist, das mit möglichst wenigen Prinzipien auskommt. Diese Idee impliziert, dass Sprache auf einem „minimalen“ Satz universeller Regeln basiert, deren wichtigste Eigenschaft die Fähigkeit zur unendlichen Generierung durch rekursive Strukturen ist. Dadurch kann mit einem endlichen Wortschatz eine unbegrenzte Anzahl von Sätzen gebildet werden.
Die Autoren argumentieren, dass viele kognitive Systeme in Tieren, etwa zur Objekterkennung oder Zahlenverarbeitung, eine evolutionäre Grundlage für FLB bieten, jedoch keine Hinweise auf FLN existieren. Dies stützt die Annahme, dass FLN in der menschlichen Evolution neu entstanden ist.
Beleg für diese Aussagen
Hauser, M. D., Chomsky, N., & Fitch, W. T. (2002). The faculty of language: what is it, who has it, and how did it evolve?. Science (New York, N.Y.), 298(5598), 1569–1579. https://doi.org/10.1126/science.298.5598.1569
Die Hypothese der genetischen Mutation
Chomsky vermutete, dass diese Fähigkeit vor 50.000–100.000 Jahren durch eine genetische Mutation entstand und Sprache so zu einem einzigartigen menschlichen Merkmal machte.
Beleg für diese Aussagen
Hauser, M. D., Chomsky, N., & Fitch, W. T. (2002). The faculty of language: what is it, who has it, and how did it evolve?. Science (New York, N.Y.), 298(5598), 1569–1579. https://doi.org/10.1126/science.298.5598.1569
Kritik an der Universalgrammatik
Kritik 1: Zu komplexe Theorie?
Viele Linguisten argumentieren, dass Chomskys Modell zu komplex sei und empirisch nur schwer haltbar ist. Zahlreiche Forscher haben Chomskys Annahme, wir hätten ein angeborenes Grammatikmodul aufgegeben. Neue empirische Erkenntnisse aus verschiedenen Sprachen und Studien zum Spracherwerb stützen nicht die Annahmen seiner Theorie. Stattdessen zeigt sich, dass Kinder beim Erstspracherwerb vor allem universelle kognitive Fähigkeiten nutzen, etwa Kategorienbildung und das Erfassen von Intentionen anderer, und nicht speziell sprachspezifische Module.
Belege für diese Aussagen
Lin, F. Y. (2017). A refutation of universal grammar. Lingua, 193, 1–22. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2017.04.003
Dąbrowska, E. (2015). What exactly is Universal Grammar, and has anyone seen it? Frontiers in Psychology, 6, 852. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00852
Kritik 2: Sprachen ohne Rekursion?
Der Fall der Amazonas‑Sprache Pirahã stellt eine besondere Herausforderung dar: Sie scheint keine rekursiven Strukturen zu nutzen. Dieser Aspekt war jedoch lange ein zentrales Argument von Chomsky. Zwar hat Chomsky diese Beobachtung zurückgewiesen, doch kritische Wissenschaftler wie Mike Tomasello unterstützen den Forscher Everett und argumentieren, dass grammatikalische Muster kulturell geprägt sein können und sich fundamental unterscheiden.
Belege für diese Aussagen
Everett, DanielL. (2005). Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã: Another Look at the Design Features of Human Language. Current Anthropology, 46(4), 621–646. https://doi.org/10.1086/431525
Kritik 3: Poverty of the Stimulus – Argumente in Frage gestellt
Chomskys zentrales Argument zur Unterstützung der Universalgrammatik ist das sogenannte „poverty of the stimulus“: Kinder hätten nicht genug sprachlichen Input, um Sprache rein induktiv zu erlernen. Doch Kritiker wie Pullum und Scholz haben gezeigt, dass die Sprachumgebung doch reich genug strukturiert ist, um Sprachstrukturen mit statistisch‑kinetischen Lernmethoden zu erfassen. Außerdem haben neuere Ansätze mit rekurrenten neuronalen Netzen demonstriert, dass hierarchische Strukturen auch ohne vorgegebene grammatische Voreinstellungen gelernt werden können.
Belege für diese Aussagen
Pullum, G. K., & Scholz, B. C. (2002). Empirical assessment of stimulus poverty arguments. The Linguistic Review, 19(1-2), 9–50. https://doi.org/10.1515/tlir.19.1-2.9
Bedeutung für die Sprachwissenschaft
Die Theorie führte zu einem Paradigmenwechsel: Sprache ist kein bloßes erlerntes Verhalten, sondern ein Teil der menschlichen Kognition. Der Behaviorismus verlor an Relevanz für das Sprachenlernen und der Kognitivismus gewann an Bedeutung.
Universalgrammatik hat die Forschung an bisher wenig dokumentierten Sprachen vorangetrieben und das Verständnis menschlicher Kommunikation erweitert.
Fazit – Ist Universalgrammatik bewiesen?
Obwohl die Theorie umstritten ist, bleibt sie ein zentraler Ausgangspunkt in der modernen Sprachwissenschaft und der kognitiven Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was ist Universalgrammatik?
Eine von Noam Chomsky entwickelte Theorie, die besagt, dass alle Menschen mit einem angeborenen Sprachmodul ausgestattet sind.
Ist Universalgrammatik bewiesen?
Nein, sie bleibt umstritten, aber sie hat wichtige Impulse für die Forschung geliefert.
Gibt es Sprachen ohne Rekursion?
Die Sprache Pirahã wird oft als Beispiel dafür genannt – ein Argument gegen die Rekursionshypothese.
Was ist der Unterschied zwischen Prinzipien und Parametern?
Prinzipien gelten für alle Sprachen, Parameter bestimmen die spezifische Ausprägung in einzelnen Sprachen.
Hat Chomsky seine Theorie überarbeitet?
Ja, zuletzt 2002, als er Rekursion als zentrales Merkmal definierte.
Warum ist die Theorie so bedeutend?
Sie veränderte unser Verständnis von Sprache, Lernen und menschlicher Kognition grundlegend
Nächster Beitrag
Was ist Psycholinguistik?
Die Psycholinguistik legt den Fokus auf den Erwerb, Besitz und Verlust von Sprache, der an psychische Voraussetzungen gebunden ist.
Quellen
Dąbrowska, E. (2015). What exactly is Universal Grammar, and has anyone seen it? Frontiers in Psychology, 6, 852. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00852
Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) 2013. WALS Online (v2020.4) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.13950591 (Available online at https://wals.info, Accessed on 2025-07-28.)
Everett, DanielL. (2005). Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã: Another Look at the Design Features of Human Language. Current Anthropology, 46(4), 621–646. https://doi.org/10.1086/431525
Hauser, M. D., Chomsky, N., & Fitch, W. T. (2002). The faculty of language: what is it, who has it, and how did it evolve?. Science (New York, N.Y.), 298(5598), 1569–1579. https://doi.org/10.1126/science.298.5598.1569
Lin, F. Y. (2017). A refutation of universal grammar. Lingua, 193, 1–22. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2017.04.003
Methling, R. (2024). Germanistische Linguistik für Dummies. Wiley-VCH.
Pullum, G. K., & Scholz, B. C. (2002). Empirical assessment of stimulus poverty arguments. The Linguistic Review, 19(1-2), 9–50. https://doi.org/10.1515/tlir.19.1-2.9